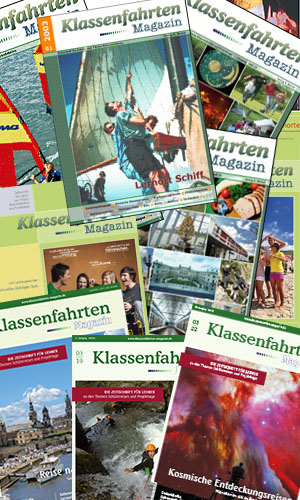Außergewöhnliche Lernorte
Schauhöhlen und Besucherbergwerke – geschichtliche Zeugnisse im Erdinneren
Außerschulische Lernorte gibt es viele. Die meisten davon befinden sich übertage. Aber auch untertage existieren Orte, die viel Interessantes vermitteln, die geschichtliche Zeugnisse bewahren. Zum einen sind es Orte in der Unterwelt, die auf natürliche Weise entstanden sind, wie Höhlen. Und zum anderen handelt es sich um von Menschenhand geschaffene Hohlräume untertage, wie Bergwerke.

Foto: Saalfelder Feengrotten, © Florian Trykowski
Was die Höhlen betrifft, so nahmen und nehmen diese unter den Naturwundern dieser Erde eine besondere Stellung ein. Dunkle Portale, enge Felsspalten oder Abstiege in einen dunklen, unergründlichen Schlund – seit Menschengedenken wurden die Höhlen teils voller Ehrfurcht bestaunt, teils vor Schauder gemieden. Dem Volksmund nach waren sie das Versteck von sagenumwobenen Goldschätzen, oder seltsame Wesen bis hin zu grässlichen Monstern sollen sich in ihnen verborgen haben.
Einige der Höhlen sind für Besucher erschlossen. Es handelt sich dabei um sogenannte Schauhöhlen. Diese natürlichen unterirdischen Hohlräume wurden durch das Anlegen von Wegen und Treppen und durch die Ausstattung mit Beleuchtung für den Besucherverkehr ausgebaut. Nur zwei Höhlen in Bayern, die Osterhöhle und die Schellenberger Eishöhle, verfügen nicht über eine elektrische Beleuchtung und können nur per Taschenlampen beziehungsweise Karbidlampen erkundet werden. Als erste deutsche Schauhöhle erhielt 1884 die Olgahöhle in Baden-Württemberg eine elektrische Beleuchtung.
In Deutschland gibt es derzeit über 50 Schauhöhlen, die im Rahmen von Führungen zu besichtigen sind. Die Besucherzahl der Schauhöhlen liegt bei etwa zwei Millionen Besuchern jährlich. Das größte Besucheraufkommen können dabei die Atta-Höhle in Attendorn in Nordrhein-Westfalen und die Teufelshöhle bei Pottenstein in Bayern verzeichnen.
Die älteste Höhle mit Führungsbetrieb ist die Baumannshöhle in Rübeland im Harz, welche schon Johann Wolfgang von Goethe besuchte. Bereits im Jahr 1646 wurden hier Höhlenführungen durchgeführt.
Vielfältig sind die Höhlenarten, wobei die jeweilige Bezeichnung der Kategorie selbsterklärend ist. So gibt es Tropfsteinhöhlen, Felshöhlen, Gipshöhlen, Kluft- und Spaltenhöhlen, Schachthöhlen, Eishöhlen, Bachhöhlen und Wasserhöhlen.

Iberger Tropfsteinhöhle, Foto: © Günter Jentsch, HEZ
Bei mehr als der Hälfte der Schauhöhlen handelt es sich jedoch um Tropfsteinhöhlen. Zu den meist besuchten Tropfsteinhöhlen in Deutschland zählen beispielsweise in Bayern die Binghöhle in Streitberg, das Schulerloch in Essing und die Sophienhöhle in Ahorntal; in Baden-Württemberg die Bärenhöhle in Sonnenbühl, die Charlottenhöhle in Hürben, die Eberstadter Tropfsteinhöhle und die Nebelhöhle in Sonnenbühl; in Nordrhein-Westfalen die Bilsteinhöhle in Warstein und die Dechenhöhle in Iserlohn; in Niedersachsen die Schillathöhle in Hessisch Oldendorf und die Iberger Tropfsteinhöhle in Bad Grund; und in Thüringen die Saalfelder Feengrotten.
In Hayingen in Baden-Württemberg befindet sich die Wimsener Höhle. Sie ist eine Wasserhöhle und als einzige Schauhöhle in Deutschland mit dem Kahn auf einer Länge von 70 Metern befahrbar.
Die Goetz-Höhle in Meiningen in Thüringen ist die einzige für den Besucherverkehr zugelassene deutsche Kluft- und Spaltenhöhle und die größte begehbare dieser Art in Europa.
Zur Kategorie Schachthöhle zählt die Laichinger Tiefenhöhle in Baden-Württemberg, welche die einzige zur Schauhöhle ausgebaute und somit für die Öffentlichkeit zugängliche Schachthöhle in Deutschland ist. Mit einer begehbaren Tiefe von
55 Metern unter dem Eingang wird hier auch der tiefste Punkt in einer deutschen Schauhöhle erreicht.
Die einzige ausgebaute Eishöhle in Deutschland, mit einem geschätzten Eisvolumen von etwa 60.000 Kubikmetern und seit 1925 als Schauhöhle geführt, ist die Schellenberger Eishöhle in Marktschellenberg in Bayern.
Im bayerischen Obermaiselstein ist die Sturmannshöhle zu finden, die zur Gattung der sogenannten Aktiven Bachhöhlen gehört.
Bei den Höhlen Hohler Fels in Schelklingen in Baden-Württemberg, der Kluterhöhle in Ennepetal in Nordrhein-Westfalen und der Wendelsteinhöhle in Brannenburg in Bayern handelt es sich um Felshöhlen.
Zu den Gipshöhlen gehört die Barbarossahöhle in Rottleben in Thüringen. In dieser Höhle hängen die gelösten Gipsschichten wie Tapeten von Decken und Wänden. Und auch die Segeberger Kalkberghöhle in Schleswig-Holstein sowie die Heimkehle in Uftrungen in Sachsen-Anhalt sind Gipshöhlen. Letztere ist eine der größten öffentlich zugänglichen Gipshöhlen Deutschlands.
Alle diese Höhlen lassen erahnen, was sich mancherorts unbekannterweise unter der Erdoberfläche befindet. Denn große Teile Deutschlands liegen in verkarstetem Gestein mit unterirdischer Entwässerung und kleineren sowie größeren Höhlen. Das Wasser hat in weiten Teilen von Bayern, Baden-Württemberg, aber auch Hessen und Thüringen im Untergrund weit verzweigte Abflusswege geschaffen, wodurch Hohlräume entstanden. Meistens ist den Menschen der Zutritt zu diesen Hohlräumen verwehrt. Aber anhand der Schauhöhlen kann man sich ein Bild davon machen, welche Naturwunder im Untergrund existieren.
Schauhöhlen lassen sich, in fachkundiger Begleitung, auf ungefährliche Weise erkunden. Für einen solchen Besuch muss man nicht schwindelfrei oder besonders „geländegängig“ sein. Manche Höhlen sind sogar behindertengerecht ausgestattet. Bezüglich des pädagogischen Wertes eines Höhlenbesuches finden sich in den Lehrplänen der Bundesländer verschiedene thematische Anknüpfungspunkte, so beispielsweise Erdgeschichte und Geowissenschaften; Evolution; Bodenschätze; Karstwasser; Trinkwasser als Ressource; oder bedrohte Tierarten wie Fledermäuse. Im Rahmen von Exkursionen können solche Lerninhalte vor Ort vertieft werden.

Foto: © Besucherbergwerk Tiefer Stollen Aalen
Ein Höhlenbesuch kann auch zum besseren Landschaftsverständnis und damit zu einem „geologischen“ Blick auf die Natur führen. Denn abgesehen davon, dass jede Naturhöhle ein einzigartiges geologisches Naturdenkmal darstellt, beherbergen diese Hohlräume auch seit Jahrtausenden eingespielte Ökosysteme.
Der Naturschutz stellt im Zusammenhang mit einem Höhlenbesuch ebenfalls ein wichtiges Kriterium dar. Daher lautet das internationale Höhlenschutzmotto:
Nimm nichts mit, außer Fotos!
Hinterlasse nur deine Fußspuren!
Schlag nichts tot, außer deiner Zeit!
Von pädagogischem Nutzen sind auch Besuche in Besucherbergwerken beziehungsweise Schaubergwerken. Hier können sich die Besucher über die Bergbautradition und Bergbaugeschichte informieren. Sie erhalten auf eindrucksvolle Weise Einblicke in die Abbaumethoden der Vergangenheit sowie die Arbeitsbedingungen der damaligen Bergleute. Denn, egal was abgebaut wurde, die Arbeit untertage war hart und gefährlich. Es war dunkel, heiß und schmutzig.
In Deutschland hat der Bergbau eine lange Tradition. Schriftliche Zeugnisse belegen, dass die Bergwerkstradition bis in das 8. Jahrhundert zurückreicht. Im 12. Jahrhundert bildeten sich die Zentren des deutschen Bergbaus aus – insbesondere im Erzgebirge in den Bergstädten Freiberg und Joachimstal sowie dann im 15. Jahrhundert in Annaberg. Zwar haben mittlerweile praktisch alle Erzbergwerke in Deutschland ihren Betrieb eingestellt und wurden stillgelegt, aber es besteht immer noch reges Interesse daran, wie die Förderung der Bodenschätze erfolgte.
Auf eine über 1.000-jährige Geschichte kann das ehemalige Erzbergwerk Rammelsberg – UNESCO Weltkulturerbe – bei Goslar in Niedersachsen zurückblicken. Es war als einziges Bergwerk der Welt kontinuierlich über 1.000 Jahre in Betrieb. Heute erwartet die Besucher unter anderem eine Grubenbahnfahrt, ein Museum und historische Wasserkunstanlagen.
Das einzige Graphitbergwerk in Deutschland ist das Graphitbergwerk Kropfmühl in Bayern. Hier können sich die Besucher im Bergbaumuseum informieren und erfahren alles rund um das Mineral Graphit. Bei der Führung untertage geht es bis in 45 Meter Tiefe.
In der einstmals weltgrößten Kalifabrik, dem Kalibergwerk Merkers in Thüringen, geht es per Seilfahrt bis 500 Meter in die Tiefe. Mit dem offenen Mannschaftswagen werden, auf über 23 Kilometer Länge und bis in 800 Meter Tiefe, verschiedene Stationen angefahren.
Eine Floßfahrt über einen Salzsee ist im Salzbergwerk Berchtesgaden in Bayern möglich. Es ist das älteste aktive Salzbergwerk Deutschlands und zugleich ein Schaubergwerk. Die Streckenlänge der Besuchergrubenbahn beträgt 1.400 Meter. Über Treppen oder Bergmannsrutschen führt der Weg tiefer in die Grube bis zu einem Salzsee.
Die Grube Schauinsland in Freiburg in Baden-Württemberg war ehemals das größte Metallerzbergwerk im Schwarzwald. Mit Hilfe originaler Werkzeuge und Maschinen erfolgt hier eine lebendige Demonstration des Silberabbaus.
Das Besondere des Besucherbergwerks F60 in Brandenburg ist die ehemalige Abraumförderbrücke F60. Sie besitzt nicht nur gigantische Ausmaße, sondern ist auch die größte mobile Maschine der Welt. Im Rahmen von geführten Rundgängen kann man die 502 Meter lange, 202 Meter breite und 80 Meter hohe Anlage kennenlernen, mit Aussicht auf eine ehemalige Mondlandschaft, welche langsam von der Natur zurückerobert wird.
Ein Bergwerksmuseum des Harzer Flussspat- und Silberbergbaus ist die Grube Glasebach in Sachsen-Anhalt. Die gesamte Anlage mit den Tagesgebäuden aus den 1950er Jahren steht als technisches Denkmal des Harzer Bergbaus unter Denkmalschutz. Bei der Führung untertage geht es 40 Meter in die Tiefe zu Schächten und Abbauhohlräumen aus zwei Jahrhunderten.
Um ein Marmor- und Skarnerzbergwerk handelt es sich beim Schaubergwerk Herkules-Frisch-Glück. Es ist das älteste Schaubergwerk Sachsens. Nach einem Einstieg über 250 Stufen bis in 80 Meter Tiefe erwartet die Besucher eine besondere Atmosphäre. Inmitten von zwei Marmorsälen und unterirdischen Seen vermittelt eine Führung Einblicke in die Bergbautätigkeit früherer Tage.
Verschiedene der Besucherbergwerke haben spezielle Angebote für Schulklassen. Bei einem Besuch sollte beachtet werden, dass in fast allen Schaubergwerken auch im Sommer meist konstant niedrige Temperaturen von um die 10 Grad Celsius herrschen. Warme und strapazierfähige Kleidung sowie festes Schuhwerk wären daher angebracht.
Autorin: © Katrin Mickel | Freie Texterin | www.katrin-mickel.de